
Wissenschaft
Cochrane Update: Elektromechanisches Gangtraining
Helfen elektronische oder robotergestützte Gehtrainingsgeräte Menschen nach einem Schlaganfall, besser zu gehen?

Jakob Tiebel
Unternehmensberater Gesundheitswesen
Rationale
Gehstörungen sind nach einem Schlaganfall häufig. In der Rehabilitation können elektromechanische und robotergestützte Gangtrainingsgeräte dazu beitragen, die Gehfähigkeit zu verbessern. Da sich die Evidenzlage und die Sicherheit der bisherigen Erkenntnisse seit dem letzten Update im Jahr 2020 verändert haben könnten, verfolgten die Forscher das Ziel, die wissenschaftlichen Daten zu den Nutzen und zur Akzeptanz dieser Technologien zu aktualisieren, um ihre Rolle in der Schlaganfallrehabilitation neu zu bewerten.
Ziele der Übersichtsarbeit
Primäres Ziel
Die Übersichtsarbeit untersuchte, ob elektromechanisch- und robotergestütztes Gangtraining im Vergleich zur Physiotherapie (oder zur Standardversorgung) die Gehfähigkeit von Erwachsenen nach einem Schlaganfall verbessert.
Sekundäre Ziele
Zudem wurde geprüft, ob diese Therapieform im Vergleich zur Physiotherapie (oder Standardversorgung) nach einem Schlaganfall die Gehgeschwindigkeit, die Gehstrecke, die Akzeptanz der Behandlung und die Gesamtsterblichkeit bis zum Ende der Interventionsphase beeinflusst
Die Übersichtsarbeit untersuchte, ob elektromechanisch- und robotergestütztes Gangtraining im Vergleich zur Physiotherapie (oder zur Standardversorgung) die Gehfähigkeit von Erwachsenen nach einem Schlaganfall verbessert.
Sekundäre Ziele
Zudem wurde geprüft, ob diese Therapieform im Vergleich zur Physiotherapie (oder Standardversorgung) nach einem Schlaganfall die Gehgeschwindigkeit, die Gehstrecke, die Akzeptanz der Behandlung und die Gesamtsterblichkeit bis zum Ende der Interventionsphase beeinflusst
Suchmethodik
Für die Übersichtsarbeit durchsuchten die Wissenschaftler verschiedene Datenbanken, darunter CENTRAL, MEDLINE, Embase sowie sieben weitere Datenbanken. Zusätzlich wurden relevante Konferenzbände durchsucht, Studien- und Forschungsregister berücksichtigt, Literaturverzeichnisse geprüft und Studienautoren kontaktiert, um weitere veröffentlichte, unveröffentlichte und laufende Studien zu identifizieren. Der letzte Suchzeitpunkt war im Dezember 2023.
Einschlusskriterien
In die Übersichtsarbeit eingeschlossen wurden alle randomisierten kontrollierten Studien sowie randomisierte Crossover-Studien an Personen ab 18 Jahren mit Schlaganfall jeglicher Schwere und in jeder Phase und Versorgungssituation. Verglichen wurde der Einsatz von elektromechanischen und robotergestützten Gangtrainingsgeräten mit Physiotherapie (oder Standardversorgung).
Erhobene Endpunkte
Der wichtigste Endpunkt war die Fähigkeit, selbstständig gehen zu können, gemessen anhand der Functional Ambulation Category (FAC). Ein FAC-
Wert von 4 oder 5 zeigte an, dass die Betroffenen auf einer Strecke von 15 Metern – gegebenenfalls unter Nutzung von Hilfsmitteln wie Gehstöcken – selbstständig gehen konnten. Ein FAC-Wert unter 4 zeigte eine Abhängigkeit beim Gehen an (erforderliche Beaufsichtigung oder Unterstützung beim Gehen).
Zu den weiteren Endpunkten gehörten die Gehgeschwindigkeit, die Gehstrecke (6-Minuten-Gehtest) sowie die Anzahl der Studienabbrüche.
Wert von 4 oder 5 zeigte an, dass die Betroffenen auf einer Strecke von 15 Metern – gegebenenfalls unter Nutzung von Hilfsmitteln wie Gehstöcken – selbstständig gehen konnten. Ein FAC-Wert unter 4 zeigte eine Abhängigkeit beim Gehen an (erforderliche Beaufsichtigung oder Unterstützung beim Gehen).
Zu den weiteren Endpunkten gehörten die Gehgeschwindigkeit, die Gehstrecke (6-Minuten-Gehtest) sowie die Anzahl der Studienabbrüche.
Besonders profitieren Menschen in den ersten drei Monaten nach dem Schlaganfall – aber auch danach.
Bewertung des Verzerrungsrisikos
Für die Bewertung des Verzerrungsrisikos (Risiko für Bias) verwendeten die Forscher das Cochrane-Instrument Risk of Bias Tool in der Version 1 (kurz: RoB 1). Dieses Instrument wurde von der Cochrane Collaboration entwickelt und dient dazu, die Qualität und Vertrauenswürdigkeit von klinischen Studien systematisch einzuschätzen. Dabei werden verschiedene potenzielle Bias-Quellen berücksichtigt, zum Beispiel die Randomisierung, die Verblindung von Teilnehmern und Studienpersonal sowie der Umgang mit unvollständigen Daten. Jede dieser Kategorien wird einzeln bewertet, um ein möglichst differenziertes Bild über die Verzerrungsanfälligkeit der untersuchten Studien zu erhalten.
Methodik der Auswertung
Zwei Gutachter wählten unabhängig voneinander die Studien für die Analyse aus, beurteilten deren methodische Qualität und Verzerrungsrisiken und extrahierten die relevanten Daten.
Für die Metaanalyse nutzten die Autoren Zufallseffektmodelle (random effects models). Diese Modelle berücksichtigen, dass die eingeschlossenen Studien
sich hinsichtlich ihrer Ergebnisse und Rahmenbedingungen unterscheiden können. Dadurch wird angenommen, dass die wahren Effekte von Studie zu Studie variieren, was eine realistischere Schätzung des Gesamteffekts ermöglicht, wenn Heterogenität zwischen den Studien vorliegt.
Die Evidenzsicherheit wurde nach dem GRADE-Ansatz (Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluation) bewertet. Dieses international anerkannte System bewertet die Vertrauenswürdigkeit der Gesamtevidenz auf Basis mehrerer Kriterien wie Studienqualität, Inkonsistenz der Ergebnisse, indirekte Evidenz, Ungenauigkeit und Publikationsbias. Das Ergebnis ist eine Einordnung der Evidenz in vier Stufen: hoch, moderat, niedrig oder sehr niedrig.
Für die Metaanalyse nutzten die Autoren Zufallseffektmodelle (random effects models). Diese Modelle berücksichtigen, dass die eingeschlossenen Studien
sich hinsichtlich ihrer Ergebnisse und Rahmenbedingungen unterscheiden können. Dadurch wird angenommen, dass die wahren Effekte von Studie zu Studie variieren, was eine realistischere Schätzung des Gesamteffekts ermöglicht, wenn Heterogenität zwischen den Studien vorliegt.
Die Evidenzsicherheit wurde nach dem GRADE-Ansatz (Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluation) bewertet. Dieses international anerkannte System bewertet die Vertrauenswürdigkeit der Gesamtevidenz auf Basis mehrerer Kriterien wie Studienqualität, Inkonsistenz der Ergebnisse, indirekte Evidenz, Ungenauigkeit und Publikationsbias. Das Ergebnis ist eine Einordnung der Evidenz in vier Stufen: hoch, moderat, niedrig oder sehr niedrig.
Eingeschlossene Studien
Die aktualisierte Übersichtsarbeit schloss insgesamt 101 Studien ein (darunter 39 neue sowie 62 aus früheren Versionen). Insgesamt wurden die Daten von 4.224 Personen nach Schlaganfall ausgewertet.
Ergebnisse der Analyse
dass elektromechanisch-assistiertes Gangtraining in Kombination mit Physiotherapie wahrscheinlich die Gehfähigkeit nach einem Schlaganfall verbessert. In den Studien zeigte sich, dass Patienten unter dieser Therapie häufiger wieder selbstständig gehen konnten als Patienten ohne diese Trainingsform (Odds Ratio 1,65).
Das 95 %-Konfidenzintervall reicht von 1,21 bis 2,25, was bedeutet, dass der wahre Effekt mit hoher Wahrscheinlichkeit innerhalb dieses Bereichs liegt. Der p-Wert von 0,001 zeigt eine statistisch signifikante Überlegenheit der Intervention. Die Heterogenität zwischen den Studien war moderat (I² = 31 %), was auf relativ gut vergleichbare Studienergebnisse hinweist. Insgesamt basieren diese Resultate auf 51 Studien mit insgesamt 2.148 Teilnehmern. Die Evidenz wurde gemäß dem GRADE-Ansatz als moderat sicher eingestuft, was bedeutet, dass ein weiterer Forschungsbedarf besteht, die Ergebnisse jedoch insgesamt sehr zuverlässig sind.
Hinsichtlich der Gehgeschwindigkeit ergab sich kein klinisch bedeutsamer Unterschied zwischen den Gruppen. Zwar zeigte sich ein statistisch signifikanter Unterschied mit einer mittleren Differenz (MD) von 0,05 Metern pro Sekunde zugunsten der elektromechanisch-assistierten Gangtherapie (95 %-Konfidenzintervall 0,02 bis 0,08; p < 0,001; I² = 58 %; 73 Studien mit insgesamt 3043 Teilnehmern), doch fällt dieser Zuwachs in der Geschwindigkeit eher gering aus und dürfte für die meisten Betroffenen
im Alltag keine spürbare Verbesserung der Gehfunktion darstellen. Die Evidenz wurde als moderat sicher bewertet.
Auch bei der zurückgelegten Gehstrecke im 6-Minuten-Gehtest zeigte sich kein relevanter klinischer Unterschied. Die durchschnittlich zusätzlich zurückgelegte Strecke lag bei 11 Metern (MD 11 Meter; 95%-Konfidenzintervall 1,8 bis 20,3 Meter; p = 0,02; I² = 43%; 42 Studien mit 1966 Teilnehmern). Obwohl dieser Unterschied statistisch signifikant war, bleibt der tatsächliche Zugewinn auch hier auf einem Niveau, das im praktischen Alltag der Betroffenen voraussichtlich nur eine geringe oder keine spürbare Verbesserung bedeutet. Die Evidenz hierzu wurde mit hoher Sicherheit eingestuft.
Hinsichtlich der Therapietreue und Sicherheit zeigte sich, dass die elektromechanisch-assistierte Gangtherapie weder die Wahrscheinlichkeit eines Studienabbruchs noch das Risiko einer Todesfolge im Vergleich zur Physiotherapie oder Standardversorgung veränderte. Für diese Endpunkte lag eine Evidenz mit hoher Sicherheit vor.
Das 95 %-Konfidenzintervall reicht von 1,21 bis 2,25, was bedeutet, dass der wahre Effekt mit hoher Wahrscheinlichkeit innerhalb dieses Bereichs liegt. Der p-Wert von 0,001 zeigt eine statistisch signifikante Überlegenheit der Intervention. Die Heterogenität zwischen den Studien war moderat (I² = 31 %), was auf relativ gut vergleichbare Studienergebnisse hinweist. Insgesamt basieren diese Resultate auf 51 Studien mit insgesamt 2.148 Teilnehmern. Die Evidenz wurde gemäß dem GRADE-Ansatz als moderat sicher eingestuft, was bedeutet, dass ein weiterer Forschungsbedarf besteht, die Ergebnisse jedoch insgesamt sehr zuverlässig sind.
Hinsichtlich der Gehgeschwindigkeit ergab sich kein klinisch bedeutsamer Unterschied zwischen den Gruppen. Zwar zeigte sich ein statistisch signifikanter Unterschied mit einer mittleren Differenz (MD) von 0,05 Metern pro Sekunde zugunsten der elektromechanisch-assistierten Gangtherapie (95 %-Konfidenzintervall 0,02 bis 0,08; p < 0,001; I² = 58 %; 73 Studien mit insgesamt 3043 Teilnehmern), doch fällt dieser Zuwachs in der Geschwindigkeit eher gering aus und dürfte für die meisten Betroffenen
im Alltag keine spürbare Verbesserung der Gehfunktion darstellen. Die Evidenz wurde als moderat sicher bewertet.
Auch bei der zurückgelegten Gehstrecke im 6-Minuten-Gehtest zeigte sich kein relevanter klinischer Unterschied. Die durchschnittlich zusätzlich zurückgelegte Strecke lag bei 11 Metern (MD 11 Meter; 95%-Konfidenzintervall 1,8 bis 20,3 Meter; p = 0,02; I² = 43%; 42 Studien mit 1966 Teilnehmern). Obwohl dieser Unterschied statistisch signifikant war, bleibt der tatsächliche Zugewinn auch hier auf einem Niveau, das im praktischen Alltag der Betroffenen voraussichtlich nur eine geringe oder keine spürbare Verbesserung bedeutet. Die Evidenz hierzu wurde mit hoher Sicherheit eingestuft.
Hinsichtlich der Therapietreue und Sicherheit zeigte sich, dass die elektromechanisch-assistierte Gangtherapie weder die Wahrscheinlichkeit eines Studienabbruchs noch das Risiko einer Todesfolge im Vergleich zur Physiotherapie oder Standardversorgung veränderte. Für diese Endpunkte lag eine Evidenz mit hoher Sicherheit vor.
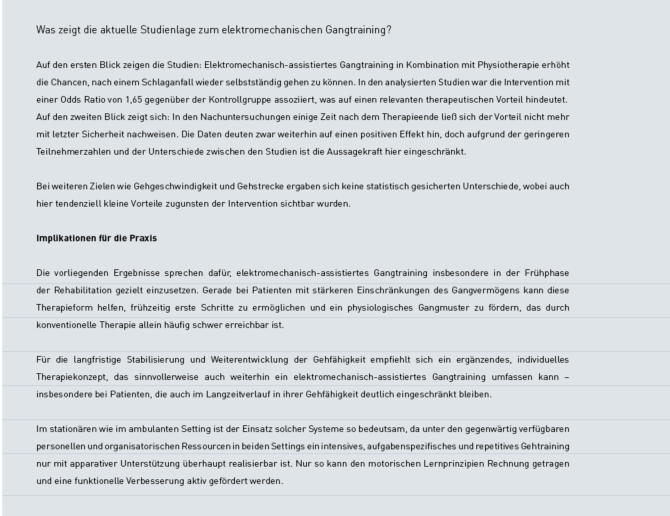
Langzeiteffekte nach Abschluss der Intervention
In den Nachuntersuchungen nach Studienende zeigte sich, dass elektromechanisch-assistiertes Gangtraining in Kombination mit Physiotherapie möglicher-weise nicht die Chance auf unabhängiges Gehen erhöht (OR 1,64; 95%-KI 0,77 bis 3,48; p = 0,20; I² = 69%; 8 Studien; 569 Teilnehmer; Evidenz mit niedriger Sicherheit).
Auch bei Gehgeschwindigkeit (MD 0,05 m/s; 95%-KI −0,03 bis 0,13; p = 0,22; I² = 66%; 17 Studien; 857 Teilnehmer; Evidenz mit moderater Sicherheit) und Gehstrecke (MD 9,6 Meter; 95%-KI −14,6 bis 33,7; p = 0,44; I² = 53%; 15 Studien; 736 Teilnehmer; Evidenz mit moderater Sicherheit) ergaben sich keine signifikanten Unterschiede.
Die Forscher weisen darauf hin, dass die Ergebnisse mit Vorsicht interpretiert werden sollten. Zum einen wurden in einigen Studien auch Personen eingeschlossen, die bereits zu Studienbeginn selbstständig gehen konnten. Zum anderen bestanden zwischen den Studien Unterschiede hinsichtlich der eingesetzten Geräte, der Behandlungsdauer und der Therapiefrequenz.
Auch bei Gehgeschwindigkeit (MD 0,05 m/s; 95%-KI −0,03 bis 0,13; p = 0,22; I² = 66%; 17 Studien; 857 Teilnehmer; Evidenz mit moderater Sicherheit) und Gehstrecke (MD 9,6 Meter; 95%-KI −14,6 bis 33,7; p = 0,44; I² = 53%; 15 Studien; 736 Teilnehmer; Evidenz mit moderater Sicherheit) ergaben sich keine signifikanten Unterschiede.
Die Forscher weisen darauf hin, dass die Ergebnisse mit Vorsicht interpretiert werden sollten. Zum einen wurden in einigen Studien auch Personen eingeschlossen, die bereits zu Studienbeginn selbstständig gehen konnten. Zum anderen bestanden zwischen den Studien Unterschiede hinsichtlich der eingesetzten Geräte, der Behandlungsdauer und der Therapiefrequenz.
Es wird weitere Forschung benötigt, um herauszufinden, wie oft und wie lange diese Geräte eingesetzt werden sollten.
Schlussfolgerungen der Autoren
Die Übersichtsarbeit kommt zu dem Ergebnis, dass elektromechanisch-assistiertes Gangtraining in Kombination mit Physiotherapie nach einem Schlaganfall mit moderater Evidenzsicherheit dazu beitragen kann, die selbstständige Gehfähigkeit wiederzuerlangen. Auf Basis der vorliegenden Daten wird geschätzt, dass etwa neun Patienten behandelt werden müssen, um bei einem Patienten eine anhaltende Geh-Abhängigkeit zu verhindern (Number Needed to Treat = 9).
Für die zukünftige Forschung empfehlen die Autoren groß angelegte, praxisnahe Phase-3-Studien, um insbesondere Fragen zur optimalen Behandlungsfrequenz, Therapiedauer und zur Nachhaltigkeit der erzielten Effekte gezielter untersuchen zu können. Darüber hinaus sollte der Zeitpunkt der Intervention im Verlauf nach dem Schlaganfall in zukünftigen Studien verstärkt berücksichtigt werden.
Für die zukünftige Forschung empfehlen die Autoren groß angelegte, praxisnahe Phase-3-Studien, um insbesondere Fragen zur optimalen Behandlungsfrequenz, Therapiedauer und zur Nachhaltigkeit der erzielten Effekte gezielter untersuchen zu können. Darüber hinaus sollte der Zeitpunkt der Intervention im Verlauf nach dem Schlaganfall in zukünftigen Studien verstärkt berücksichtigt werden.
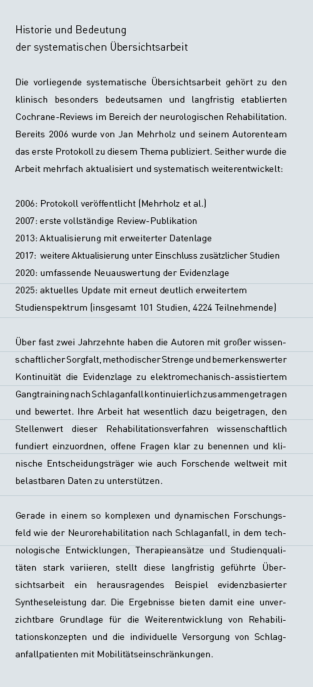
Ambulante Rehabilitation
Fachkreise
Gait
lyra
Stationäre Rehabilitation
THERAPY
THERAPY 2025-II
THERAPY Magazin
Wissenschaft

Jakob Tiebel
Unternehmensberater Gesundheitswesen
Jakob Tiebel, Ergotherapeut, Studium in angewandter Psychologie mit Schwerpunkt Gesundheitswirtschaft. Klinische Expertise durch frühere therapeutische Tätigkeit in der Neurorehabilitation. Forscht und publiziert zum Theorie-Praxis-Transfer in der Neurorehabilitation und ist Inhaber von einer Agentur für digitales Gesundheitsmarketing.
References:
- Mehrholz J, Kugler J, Pohl M, Elsner B. Electromechanical-assisted training for walking after stroke. Cochrane Database of Systematic Reviews 2025, Issue 5. Art. No.: CD006185. DOI: 10.1002/14651858.CD006185.pub6. https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD006185.pub6/full
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen