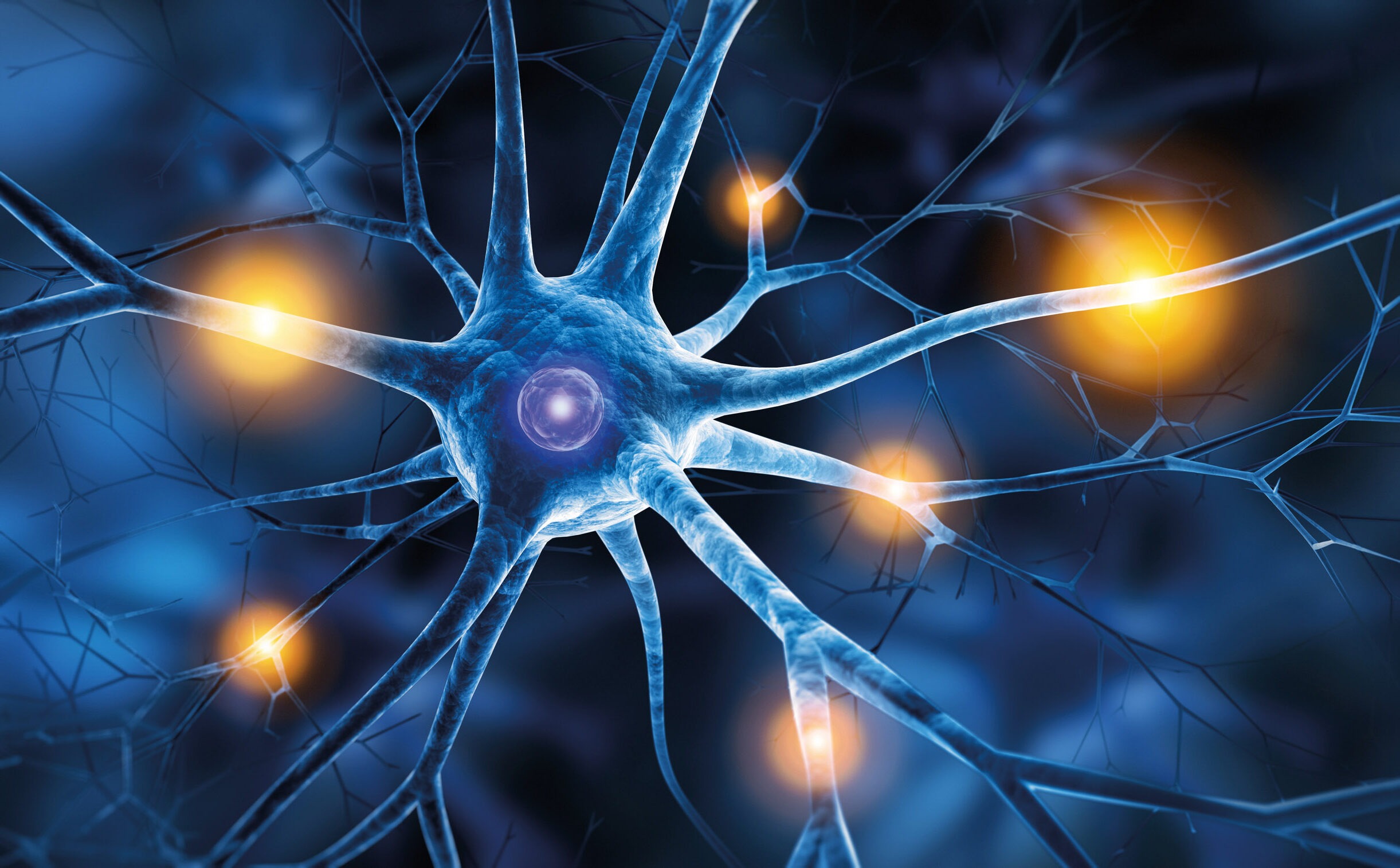
THERAPY-Magazin
Alles Nervensache! Neuronale Plastizität und motorisches Lernen
Erfahren Sie, wie neuronale Plastizität und motorisches Lernen die Grundlage für erfolgreiche Rehabilitation nach einer Nervenschädigung bilden. Durch gezieltes Üben, Feedback und wiederholte Übungen können Patienten ihre motorischen Funktionen wiedererlangen.

Jakob Tiebel
Inhaber, N+ Digital Health Agency
Die biologische Grundlage erfolgreicher motorischer Rehabilitation nach Schädigungen des Nervensystems ist die neuronale Plastizität des Gehirns. Unter dem Begriff der neuronalen Plastizität werden jene strukturellen und funktionellen Anpassungen des Gehirns verstanden, die sich aufgrund von Veränderungen in der Umwelt und nach Schädigungen des Gehirns ergeben können [1, 5].
Plastische Veränderungen im Gehirn sind durch Verhaltensänderung, Training und Lernen lebenslang möglich [6, 7]. Sie basieren vor allem auf einer Veränderung der Verbindungsstärke von Nervenzellen untereinander [8]. Die Forschungsergebnisse der letzten Jahre zeigen zudem, dass je nach Größe und Lokalisation einer Schädigung unterschiedliche Mechanismen neuronaler Plastizität dazu beitragen, dass das Nervensystem auf beeindruckende Weise funktionelle Ausfälle kompensiert [9].
Plastische Veränderungen im Gehirn sind durch Verhaltensänderung, Training und Lernen lebenslang möglich [6, 7]. Sie basieren vor allem auf einer Veränderung der Verbindungsstärke von Nervenzellen untereinander [8]. Die Forschungsergebnisse der letzten Jahre zeigen zudem, dass je nach Größe und Lokalisation einer Schädigung unterschiedliche Mechanismen neuronaler Plastizität dazu beitragen, dass das Nervensystem auf beeindruckende Weise funktionelle Ausfälle kompensiert [9].
Spontanerholung
Durch eine Schädigung im Bereich des Gehirns kommt es zu einem Untergang von Nervenzellen, der mit einem Verlust entsprechender neuronaler Funktionen einhergeht. Intakte Regionen, die außerhalb des geschädigten Hirnareals liegen, mit diesem jedoch in Verbindung standen, weisen nach einer Schädigung häufig eine verminderte Funktion auf. Im Verlauf der ersten Tage und Wochen kommt es zu spontanen Reorganisationsvorgängen, durch die sich die benachbarten Regionen wieder erholen. Das kann im Idealfall zu einer deutlichen Reduktion der anfänglichen Behinderung führen.
Durch eine Schädigung im Bereich des Gehirns kommt es zu einem Untergang von Nervenzellen, der mit einem Verlust entsprechender neuronaler Funktionen einhergeht. Intakte Regionen, die außerhalb des geschädigten Hirnareals liegen, mit diesem jedoch in Verbindung standen, weisen nach einer Schädigung häufig eine verminderte Funktion auf. Im Verlauf der ersten Tage und Wochen kommt es zu spontanen Reorganisationsvorgängen, durch die sich die benachbarten Regionen wieder erholen. Das kann im Idealfall zu einer deutlichen Reduktion der anfänglichen Behinderung führen.
In stiller Bereitschaft
Durch eine Demaskierung supprimierter interkortikaler Verbindungen (Unmasking) kann es im Verlauf zu einer Aktivierung „stiller“ Synapsen kommen [10]. Cao et al. konnten die Aktivierung der Randbereiche eines Schädigungsareales nach Schlaganfall nachweisen. Im Rahmen der Funktionserholung werden kortikale Repräsentationsfelder so modifiziert, dass bereits bestehende, aber ungenutzte, redundante Nervenverbindungen aktiviert werden [11,12].
Durch eine Demaskierung supprimierter interkortikaler Verbindungen (Unmasking) kann es im Verlauf zu einer Aktivierung „stiller“ Synapsen kommen [10]. Cao et al. konnten die Aktivierung der Randbereiche eines Schädigungsareales nach Schlaganfall nachweisen. Im Rahmen der Funktionserholung werden kortikale Repräsentationsfelder so modifiziert, dass bereits bestehende, aber ungenutzte, redundante Nervenverbindungen aktiviert werden [11,12].
Neu ausgesprosst
Für plastische Veränderungen nach einer Hirnschädigung können in der subakuten Phase auch Neuverzweigungen von Dendriten verantwortlich sein. Denervierte Neurone sind in der Lage durch Aussprossung (Sprouting) mit anderen Nervenzellen Verbindungen herzustellen. Dadurch entstehen neue Kontaktstellen zwischen Nervenzellen. Neben dem dendritischen Wachstum ist als potentieller Mechanismus für Plastizität auch das axonale Wachstum zu nennen. Da axonales Wachstum deutlich länger dauert, spielen die Mechanismen vermutlich erst Monate bis Jahre nach einer Schädigung eine nennenswerte Rolle [3,13,14]
Für plastische Veränderungen nach einer Hirnschädigung können in der subakuten Phase auch Neuverzweigungen von Dendriten verantwortlich sein. Denervierte Neurone sind in der Lage durch Aussprossung (Sprouting) mit anderen Nervenzellen Verbindungen herzustellen. Dadurch entstehen neue Kontaktstellen zwischen Nervenzellen. Neben dem dendritischen Wachstum ist als potentieller Mechanismus für Plastizität auch das axonale Wachstum zu nennen. Da axonales Wachstum deutlich länger dauert, spielen die Mechanismen vermutlich erst Monate bis Jahre nach einer Schädigung eine nennenswerte Rolle [3,13,14]
Die „Hebbsche Regel“
Als wichtigster plastizitätsinduzierender Mechanismus ist die Modulation prä- und postsynaptischer Effizienz im Sinne so genannter Long-Term-Potentiation (LTP) und Long-Term-Depression (LTD) zu nennen [15]. Das Prinzip der LTP wird auch als „Hebbsche Regel“ bezeichnet und wird als Grundlage aller Lern- und Gedächtnisprozesse angesehen. Die "Hebbsche Regel" besagt, dass die Verbindungsstärke zweier miteinander verbundener Neurone zunimmt, wenn diese synchron erregt sind und feuern [1]. Die Regel gilt für einzelne Verbindungen zwischen Nervenzellen wie auch für ganze Verbundstrukturen [18]. Den Veränderungen der Verbindungsstärke liegen Wachstumsprozesse und metabolische Veränderungen in einem oder mehreren Neuronen zugrunde [1].
Beim Modell der Long-Term-Potentiation (LTP) und Long-Term-Depression (LTD) führen also wiederholte Aktivierungsmuster an den Synapsen zu einer Veränderung der synaptischen Effizienz. So können Kontakte zu anderen Neuronen und darüber die Funktion kortikaler Verbindungen auf lange Sicht verändert werden. Daraus resultieren Veränderungen im Bereich der Erregungsschwellen sowie der rezeptiven Felder, die eine Reorganisation kortikaler Repräsentation bewirken [3, 9, 16].
Als wichtigster plastizitätsinduzierender Mechanismus ist die Modulation prä- und postsynaptischer Effizienz im Sinne so genannter Long-Term-Potentiation (LTP) und Long-Term-Depression (LTD) zu nennen [15]. Das Prinzip der LTP wird auch als „Hebbsche Regel“ bezeichnet und wird als Grundlage aller Lern- und Gedächtnisprozesse angesehen. Die "Hebbsche Regel" besagt, dass die Verbindungsstärke zweier miteinander verbundener Neurone zunimmt, wenn diese synchron erregt sind und feuern [1]. Die Regel gilt für einzelne Verbindungen zwischen Nervenzellen wie auch für ganze Verbundstrukturen [18]. Den Veränderungen der Verbindungsstärke liegen Wachstumsprozesse und metabolische Veränderungen in einem oder mehreren Neuronen zugrunde [1].
Beim Modell der Long-Term-Potentiation (LTP) und Long-Term-Depression (LTD) führen also wiederholte Aktivierungsmuster an den Synapsen zu einer Veränderung der synaptischen Effizienz. So können Kontakte zu anderen Neuronen und darüber die Funktion kortikaler Verbindungen auf lange Sicht verändert werden. Daraus resultieren Veränderungen im Bereich der Erregungsschwellen sowie der rezeptiven Felder, die eine Reorganisation kortikaler Repräsentation bewirken [3, 9, 16].
Rekruten anderer Bahnsysteme
Die Rekrutierung paralleler und funktionell ähnlicher Bahnsysteme wird als Vikariation bezeichnet. Anstelle des geschädigten Areals übernehmen andere Hirnbereiche die jeweiligen Funktionen. Dabei weisen die verwandten Kortexareale in der Regel eine ähnliche Mikrostruktur auf. Häufig zu beobachten ist, dass die homologen Strukturen der kontralateralen Hemisphäre an der Kompensation des Funktionsverlustes beteiligt sind [3, 9].
Die Rekrutierung paralleler und funktionell ähnlicher Bahnsysteme wird als Vikariation bezeichnet. Anstelle des geschädigten Areals übernehmen andere Hirnbereiche die jeweiligen Funktionen. Dabei weisen die verwandten Kortexareale in der Regel eine ähnliche Mikrostruktur auf. Häufig zu beobachten ist, dass die homologen Strukturen der kontralateralen Hemisphäre an der Kompensation des Funktionsverlustes beteiligt sind [3, 9].
Quellen für Neubildung
Die Neubildung von Neuronen sowie der Einsatz von Stammzellen zur Wiederherstellung von defekten Hirnarealen sind Gegenstand aktueller Forschungen [9]. Experimente zeigen bereits eindrücklich, dass sich transplantierte Knochenmarkzellen zu verschiedenen Nervenzelltypen differenzieren können [17].
Die Neubildung von Neuronen sowie der Einsatz von Stammzellen zur Wiederherstellung von defekten Hirnarealen sind Gegenstand aktueller Forschungen [9]. Experimente zeigen bereits eindrücklich, dass sich transplantierte Knochenmarkzellen zu verschiedenen Nervenzelltypen differenzieren können [17].
Das Hirn wächst mit seinen Aufgaben
Der Nachweis lebenslanger Plastizität unseres Nervensystems als Grundlage funktioneller motorischer Rehabilitation ist einer der entscheidenden Auslöser für den in den letzten Jahren vorangeschrittenen Paradigmenwechsel in der Neurorehabilitation. Die Erkenntnisse zur neuronalen Plastizität haben den Weg frei gemacht, Behandlungstechniken gezielt einzusetzen, um die Reorganisation des Nervensystems nach einer Schädigung günstig zu beeinflussen.
Der Nachweis lebenslanger Plastizität unseres Nervensystems als Grundlage funktioneller motorischer Rehabilitation ist einer der entscheidenden Auslöser für den in den letzten Jahren vorangeschrittenen Paradigmenwechsel in der Neurorehabilitation. Die Erkenntnisse zur neuronalen Plastizität haben den Weg frei gemacht, Behandlungstechniken gezielt einzusetzen, um die Reorganisation des Nervensystems nach einer Schädigung günstig zu beeinflussen.
Ein paar Grundsätze vorweg
An dieser Stelle sind einige grundlegende Prinzipien zu nennen, die im Rahmen der motorischen Rehabilitation zu beachten sind, um eine bestmögliche Versorgung für den Patienten zu gewährleisten.
Wichtige Prädiktoren für ein günstiges Outcome im Sinne eines möglichst geringen Behinderungsgrades nach einer neurologischen Schädigung sind der möglichst frühe Beginn der Therapie [19] und eine möglichst hohe Therapieintensität [20, 21]. Es wird angenommen, dass sich eine Überlegenheit aus der Kombination beider Faktoren zusammensetzt [22, 23]. Empfohlen wird eine tägliche Trainingsdauer, je nach Belastbarkeit des Patienten, von etwa drei Stunden in Einzel- und Gruppentherapie [24].
Als zentrale Kernelemente moderner Therapiemaßnahmen lässt sich das aktive, repetitive Üben alltagsrelevanter Fertigkeiten und Bewegungen herausstellen [21, 22, 25, 26]. Wichtige Grundlagen zum motorischen Lernen nach einer Schädigung des zentralen Nervensystems haben Carr und Shepherd 1987 und Shumway-Cook und Wollacott geliefert [27, 28]. Moderne Neurorehabilitation orientiert sich heute maßgeblich an den Prinzipien des motorischen Lernens [29]. Freivogel unterscheidet im Rahmen des motorischen Lernens das „isolierte sensomotorische Training“, bei dem einzelne Bewegungen isoliert geübt werden, und das „aufgabenorientierte Training“, bei dem alltagsrelevante Aktivitäten geübt werden. Beide Prinzipien sind in der Behandlung neurologischer Patienten relevant [26].
An dieser Stelle sind einige grundlegende Prinzipien zu nennen, die im Rahmen der motorischen Rehabilitation zu beachten sind, um eine bestmögliche Versorgung für den Patienten zu gewährleisten.
Wichtige Prädiktoren für ein günstiges Outcome im Sinne eines möglichst geringen Behinderungsgrades nach einer neurologischen Schädigung sind der möglichst frühe Beginn der Therapie [19] und eine möglichst hohe Therapieintensität [20, 21]. Es wird angenommen, dass sich eine Überlegenheit aus der Kombination beider Faktoren zusammensetzt [22, 23]. Empfohlen wird eine tägliche Trainingsdauer, je nach Belastbarkeit des Patienten, von etwa drei Stunden in Einzel- und Gruppentherapie [24].
Als zentrale Kernelemente moderner Therapiemaßnahmen lässt sich das aktive, repetitive Üben alltagsrelevanter Fertigkeiten und Bewegungen herausstellen [21, 22, 25, 26]. Wichtige Grundlagen zum motorischen Lernen nach einer Schädigung des zentralen Nervensystems haben Carr und Shepherd 1987 und Shumway-Cook und Wollacott geliefert [27, 28]. Moderne Neurorehabilitation orientiert sich heute maßgeblich an den Prinzipien des motorischen Lernens [29]. Freivogel unterscheidet im Rahmen des motorischen Lernens das „isolierte sensomotorische Training“, bei dem einzelne Bewegungen isoliert geübt werden, und das „aufgabenorientierte Training“, bei dem alltagsrelevante Aktivitäten geübt werden. Beide Prinzipien sind in der Behandlung neurologischer Patienten relevant [26].
Motorisches Lernen - eine Prinzipsache
Bewegung ist eine grundlegende und scheinbar selbstverständliche Fähigkeit des Menschen, mit seiner Umwelt in Wechselwirkung zu treten. Die bewusste Auseinandersetzung mit der Fähigkeit, sich zu bewegen, geschieht meist erst, wenn die Prozesse nicht automatisch ablaufen, da sie zum Beispiel durch eine Erkrankung beeinträchtigt sind.
Die Restitution motorischer Fertigkeiten nach Schädigung des zentralen Nervensystems ist als ein motorischer Lernprozess zu verstehen, bei dem durch gezieltes Üben Funktionen zurückgewonnen werden können. Motorische Rehabilitation ist somit eine Form des motorischen Lernens, die dem Wiedererlernen von Bewegung dient [30, 31]. Dabei hat die Art des Trainings einen entscheidenden Einfluss auf das motorische Lernen [24]. Der Prozess des motorischen Lernens kann in drei Phasen unterteilt werden. Darüber hinaus sind grundsätzliche Prinzipien zu Instruktion, Feedback, Repetition und Shaping zu beachten, die im Folgenden dargestellt werden [32].
Bewegung ist eine grundlegende und scheinbar selbstverständliche Fähigkeit des Menschen, mit seiner Umwelt in Wechselwirkung zu treten. Die bewusste Auseinandersetzung mit der Fähigkeit, sich zu bewegen, geschieht meist erst, wenn die Prozesse nicht automatisch ablaufen, da sie zum Beispiel durch eine Erkrankung beeinträchtigt sind.
Die Restitution motorischer Fertigkeiten nach Schädigung des zentralen Nervensystems ist als ein motorischer Lernprozess zu verstehen, bei dem durch gezieltes Üben Funktionen zurückgewonnen werden können. Motorische Rehabilitation ist somit eine Form des motorischen Lernens, die dem Wiedererlernen von Bewegung dient [30, 31]. Dabei hat die Art des Trainings einen entscheidenden Einfluss auf das motorische Lernen [24]. Der Prozess des motorischen Lernens kann in drei Phasen unterteilt werden. Darüber hinaus sind grundsätzliche Prinzipien zu Instruktion, Feedback, Repetition und Shaping zu beachten, die im Folgenden dargestellt werden [32].
Lernen vollzieht sich in Phasen
In der kognitiven Phase ist die Unterstützung durch den Therapeuten wichtig und förderlich für das Lernen. Die Informationen und Hilfestellungen sind jedoch auf das Wesentliche zu reduzieren. Grundsätzlich gilt in der modernen Behandlung das „hands off“-Prinzip. Nicht die Hand des Therapeuten, sondern die zielorientierte Aktivität des Patienten steht im Vordergrund. Variationen machen in dieser Phase des Lernens noch keinen Sinn und stören den Lernvorgang [26].
Die zweite Phase im Lernprozess wird als assoziative Phase bezeichnet. In dieser Phase können Übungen vorsichtig variiert werden, um den Schwierigkeitsgrad sukzessive zu erhöhen. Das gezielte Feedback durch den Therapeuten ist nach wie vor wichtig, jedoch nicht nach jeder einzelnen Bewegung, sondern nach abgegrenzten Übungsintervallen.
In der autonomen Phase kann und sollte regelmäßig mit Variationen gearbeitet werden. Mit zunehmender Performance des Patienten können zur Steigerung zusätzlich Schwierigkeiten eingebaut werden, die eine erneute Anpassung an die Bewegung erforderlich machen. Ein weiteres Ziel liegt darin, Teilaspekte der Bewegung kontinuierlich zu verbessern.
In der kognitiven Phase ist die Unterstützung durch den Therapeuten wichtig und förderlich für das Lernen. Die Informationen und Hilfestellungen sind jedoch auf das Wesentliche zu reduzieren. Grundsätzlich gilt in der modernen Behandlung das „hands off“-Prinzip. Nicht die Hand des Therapeuten, sondern die zielorientierte Aktivität des Patienten steht im Vordergrund. Variationen machen in dieser Phase des Lernens noch keinen Sinn und stören den Lernvorgang [26].
Die zweite Phase im Lernprozess wird als assoziative Phase bezeichnet. In dieser Phase können Übungen vorsichtig variiert werden, um den Schwierigkeitsgrad sukzessive zu erhöhen. Das gezielte Feedback durch den Therapeuten ist nach wie vor wichtig, jedoch nicht nach jeder einzelnen Bewegung, sondern nach abgegrenzten Übungsintervallen.
In der autonomen Phase kann und sollte regelmäßig mit Variationen gearbeitet werden. Mit zunehmender Performance des Patienten können zur Steigerung zusätzlich Schwierigkeiten eingebaut werden, die eine erneute Anpassung an die Bewegung erforderlich machen. Ein weiteres Ziel liegt darin, Teilaspekte der Bewegung kontinuierlich zu verbessern.
Inside out - wohin mit der Aufmerksamkeit
In der Therapie kann der Patient seine Aufmerksamkeit auf unterschiedliche Aspekte richten. Dies ist stark abhängig von der Instruktion des Therapeuten. Ist der Patient angewiesen, sich auf den Bewegungsablauf zu konzentrieren, wird von einem internen Fokus gesprochen. Effektiver ist jedoch eine externe Fokussierung der Aufmerksamkeit auf das Bewegungsziel. Untersuchungen von Wulf et al. zeigen, dass Bewegungen durch einen externen Fokus schneller gelernt werden. Metaphern können bei der Formulierung der Bewegungsaufträge unterstützend wirken [33, 34, 35].
Ziel einer Studie von Johnson et al. aus dem Jahr 2013 war es, die von Physiotherapeuten genutzte anteilige Verwendung von internem und externem Aufmerksamkeitsfokus während der Behandlung von Schlaganfallpatienten zu evaluieren. Im Mittel gaben die Therapeuten den Patienten 76 Instruktionen pro Therapiesitzung und 22 Rückmeldungen. Das entspricht einem Durchschnittswert von einer Instruktion alle 14 Sekunden. Viele Instruktionen gaben die Therapeuten so, dass die Patienten über viele Einzelheiten der gestellten Aufgabe nachdenken mussten. Außerdem wiederholten sich die Instruktionen innerhalb kurzer Zeit sehr oft, was dazu führte, dass Instruktionen auch während der Bewegungsdurchführung gegeben wurden. Im Mittel waren fast 70% der Instruktionen intern fokussiert und nur ca. 30% extern fokussiert bzw. gemischt. Physiotherapeuten instruieren ihre Patienten demnach in der Therapie überwiegend so, dass diese sich auf die Bewegung selbst und auf die Bewegungsausführung konzentrieren (interner Fokus). Die Autoren der Studie weisen darauf hin, dass genau dieser Ansatz die Automatisierung von Bewegungen und das motorische Lernen, sowie das Behalten von Lernerfolgen behindern kann [36].
Eine externale Fokussierung sollte vor diesem Hintergrund unbedingt favorisiert werden [33][34].
In der Therapie kann der Patient seine Aufmerksamkeit auf unterschiedliche Aspekte richten. Dies ist stark abhängig von der Instruktion des Therapeuten. Ist der Patient angewiesen, sich auf den Bewegungsablauf zu konzentrieren, wird von einem internen Fokus gesprochen. Effektiver ist jedoch eine externe Fokussierung der Aufmerksamkeit auf das Bewegungsziel. Untersuchungen von Wulf et al. zeigen, dass Bewegungen durch einen externen Fokus schneller gelernt werden. Metaphern können bei der Formulierung der Bewegungsaufträge unterstützend wirken [33, 34, 35].
Ziel einer Studie von Johnson et al. aus dem Jahr 2013 war es, die von Physiotherapeuten genutzte anteilige Verwendung von internem und externem Aufmerksamkeitsfokus während der Behandlung von Schlaganfallpatienten zu evaluieren. Im Mittel gaben die Therapeuten den Patienten 76 Instruktionen pro Therapiesitzung und 22 Rückmeldungen. Das entspricht einem Durchschnittswert von einer Instruktion alle 14 Sekunden. Viele Instruktionen gaben die Therapeuten so, dass die Patienten über viele Einzelheiten der gestellten Aufgabe nachdenken mussten. Außerdem wiederholten sich die Instruktionen innerhalb kurzer Zeit sehr oft, was dazu führte, dass Instruktionen auch während der Bewegungsdurchführung gegeben wurden. Im Mittel waren fast 70% der Instruktionen intern fokussiert und nur ca. 30% extern fokussiert bzw. gemischt. Physiotherapeuten instruieren ihre Patienten demnach in der Therapie überwiegend so, dass diese sich auf die Bewegung selbst und auf die Bewegungsausführung konzentrieren (interner Fokus). Die Autoren der Studie weisen darauf hin, dass genau dieser Ansatz die Automatisierung von Bewegungen und das motorische Lernen, sowie das Behalten von Lernerfolgen behindern kann [36].
Eine externale Fokussierung sollte vor diesem Hintergrund unbedingt favorisiert werden [33][34].
Feedback
Der Erfolg motorischen Lernens basiert im Wesentlichen auf den intrinsischen Feedbackmechanismen des Patienten. Unterschieden wird hier zwischen der Wahrnehmung der Bewegung (knowledge of performance) und dem resultierenden Ergebnis (knowledge of result).
Externe Feedbackmechanismen des Therapeuten oder beispielsweise der Einsatz von Biofeedback können den Lernprozess des Patienten erfolgreich unterstützen. Allerdings ist auch hier die Dosis entscheidend. Häufig überlagern sich intrinsisches Feedback und extrinsisches Feedback. Weniger kann hier für den Patienten oft mehr bedeuten [37, 38].
Der Therapeut hat hier vor allem die Aufgabe den Patienten so zu instruieren und zu trainieren, dass dieser in der Lage ist, das nötige intrinsische Feedback selbst zu erzeugen [31]
Der Erfolg motorischen Lernens basiert im Wesentlichen auf den intrinsischen Feedbackmechanismen des Patienten. Unterschieden wird hier zwischen der Wahrnehmung der Bewegung (knowledge of performance) und dem resultierenden Ergebnis (knowledge of result).
Externe Feedbackmechanismen des Therapeuten oder beispielsweise der Einsatz von Biofeedback können den Lernprozess des Patienten erfolgreich unterstützen. Allerdings ist auch hier die Dosis entscheidend. Häufig überlagern sich intrinsisches Feedback und extrinsisches Feedback. Weniger kann hier für den Patienten oft mehr bedeuten [37, 38].
Der Therapeut hat hier vor allem die Aufgabe den Patienten so zu instruieren und zu trainieren, dass dieser in der Lage ist, das nötige intrinsische Feedback selbst zu erzeugen [31]
Repetition
Verbindliche Angaben zur Zahl nötiger Wiederholungen zum Wiedererlernen einer Bewegung gibt es nicht. Die Wiederholungszahl ist unter anderem abhängig von der Komplexität der Bewegung und der Lernfähigkeit des Patienten. Es ist jedoch anzunehmen, dass gerade bei komplexen Bewegungsabläufen die Anzahl erforderlicher Repetitionen für das Wiedererlernen weitaus höher sein muss, als das, was in der Therapie geübt wird [26]. Mehrholz beschreibt die Repetition als „bedeutendsten Einzelfaktor für dauerhafte und anhaltende Fortschritte in der Bewegungsausführung“. Es ist die wichtigste Variable beim Lernen vieler Aktivitäten [39]. Vielfaches Wiederholen und Üben einfacher und komplexer Bewegungen sind als wesentliche Voraussetzungen für einen erfolgreichen Lernprozess anzusehen und führen zu einer nachhaltigen Automatisierung und Optimierung von Bewegungsabläufen [26, 40].
Verbindliche Angaben zur Zahl nötiger Wiederholungen zum Wiedererlernen einer Bewegung gibt es nicht. Die Wiederholungszahl ist unter anderem abhängig von der Komplexität der Bewegung und der Lernfähigkeit des Patienten. Es ist jedoch anzunehmen, dass gerade bei komplexen Bewegungsabläufen die Anzahl erforderlicher Repetitionen für das Wiedererlernen weitaus höher sein muss, als das, was in der Therapie geübt wird [26]. Mehrholz beschreibt die Repetition als „bedeutendsten Einzelfaktor für dauerhafte und anhaltende Fortschritte in der Bewegungsausführung“. Es ist die wichtigste Variable beim Lernen vieler Aktivitäten [39]. Vielfaches Wiederholen und Üben einfacher und komplexer Bewegungen sind als wesentliche Voraussetzungen für einen erfolgreichen Lernprozess anzusehen und führen zu einer nachhaltigen Automatisierung und Optimierung von Bewegungsabläufen [26, 40].
Ran an die Leistungsgrenze
Unter dem Begriff Shaping wird das sukzessive Steigern des Schwierigkeitsgrades im Rahmen des motorischen Lernens verstanden. Eine Bewegungsaufgabe sollte für den Patienten so gewählt werden, dass sie gerade noch zu bewältigen ist, und je nach Leistung kontinuierlich gesteigert werden. In Kombination mit häufiger Wiederholung (Repetition) und entsprechender Rückmeldung (Feedback) über die Erreichung des Bewegungszieles können Bewegungsprogramme immer weiter optimiert werden.
Das Ziel muss eine systematische Steigerung der Anforderungen und ein kontinuierliches Üben an der individuellen Leistungsgrenze sein [41, 42].
Unter dem Begriff Shaping wird das sukzessive Steigern des Schwierigkeitsgrades im Rahmen des motorischen Lernens verstanden. Eine Bewegungsaufgabe sollte für den Patienten so gewählt werden, dass sie gerade noch zu bewältigen ist, und je nach Leistung kontinuierlich gesteigert werden. In Kombination mit häufiger Wiederholung (Repetition) und entsprechender Rückmeldung (Feedback) über die Erreichung des Bewegungszieles können Bewegungsprogramme immer weiter optimiert werden.
Das Ziel muss eine systematische Steigerung der Anforderungen und ein kontinuierliches Üben an der individuellen Leistungsgrenze sein [41, 42].
"Durch Ihr Handeln können Sie Patienten die bestmögliche Therapie bieten."
Ambulante Rehabilitation
Fachkreise
Intensiv- & Akutpflege
Produkte
senso
Stationäre Rehabilitation
THERAPY Magazin
Wissenschaft
Wohnen im Alter & Langzeitpflege

Jakob Tiebel
Inhaber, N+ Digital Health Agency
Jakob Tiebel Studium in angewandter
Psychologie mit Schwerpunkt
Gesundheitswirtschaft. Klinische
Expertise durch frühere
therapeutische Tätigkeit in der
Neurorehabilitation. Forscht und
publiziert zum Theorie-Praxis-
Transfer in der Neurorehabilitation
und ist Inhaber von Native.
Health, einer Agentur für digitales
Gesundheitsmarketing.
References:
Verwandte Inhalte
Meet our specialists.
Are you interested in our solutions? tzkjtrzktzkmrz Schedule a meeting with a Consultant to talk through your strategy and understand how TEHRA-Trainer can help you to advance rehabilitation.