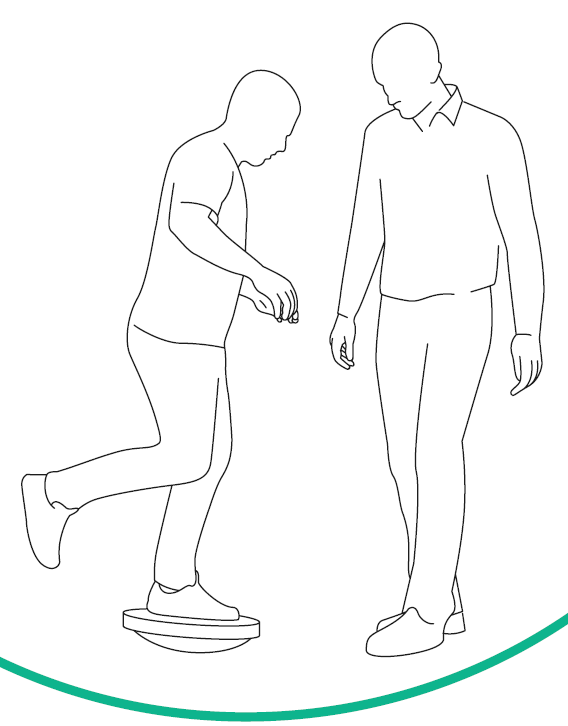
Das THERA-Konzept bietet ein einfaches und valides Assessment-Instrument zur schnellen Beurteilung der motorischen Fähigkeiten von Patienten. Es unterstützt Therapeuten bei der Strukturierung der Behandlung und Anpassung von Maßnahmen im Rehabilitationsprozess.

maßnahmen sinnvoll zu strukturieren.
Moderne Rehabilitationskonzepte sollten stets auf einer sorgfältigen Evaluation von Patientenfähigkeiten und einer genauen Zieldefinition basieren. Es handelt sich dabei um „zwei wesentliche Elemente der rationalisierten und finalisierten Rehabilitationssteuerung“ [2, 4].
Assessmentinstrumente orientieren sich heute überwiegend an den Klassifikationsebenen der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit und Behinderung (ICF) der Weltgesundheitsorganisation (WHO) [1, 5]. Der wesentliche Nutzen der ICF liegt in einer zu Grunde liegenden bio-psycho-sozialen Betrachtungsweise, die eine ganzheitliche und ressourcenorientierte Sicht auf den Patienten ermöglicht [2]. Gesundheitsprobleme werden nach ICF als Ergebnis oder Folge komplexer Beziehungen zwischen Person, personenbezogenen Faktoren und der Umwelt gesehen [6].
Die Fähigkeiten eines Patienten lassen sich auf Ebene der Körperfunktionen und Strukturen (z.B. posturale Kontrolle), der Aktivitäten (z.B. Stehen und Gehen) und der Partizipation (z.B. Teilhabe im Alltag) bestimmen. Die dafür notwendigen Messungen sollten stets zu Beginn und in regelmäßigen Abständen im Verlauf des Rehabilitationsprozesses durchgeführt werden. Dadurch können die Effekte der Behandlung überprüft und die durchgeführten Maßnahmen an ein sich veränderndes Leistungsniveau des Patienten angepasst werden. Langfristig lassen sich auf Grundlage dokumentierter Ergebnisse zudem Empfehlungen für eine Effektivierung der Therapie ableiten [7].
Aus der Vielzahl international zur Verfügung stehender Assessments ist es in der Praxis mitunter jedoch nicht leicht, ein geeignetes Verfahren für einen bestimmten Anwendungsfall zu selektieren [1]. Die meisten Rehabilitationseinrichtungen wenden routinemäßig eine Auswahl standardisierter Erhebungsverfahren an, mit denen sie in Anlehnung an die ICF die Patientenfähigkeit beurteilen und Ziele mit dem Patienten formulieren. Allerdings ist in vielen Fällen zu beobachten, dass die verwendeten Instrumente nur sporadisch und vielfach unspezifisch eingesetzt werden. Infolgedessen werden die motorischen Fähigkeiten von Patienten im Behandlungsalltag nur unzureichend erfasst. Viele der detaillierten Assessments beinhalten zwar nützliche, aber oft langwierige Messverfahren, die viel Zeit in Anspruch nehmen und viel Routine in der Anwendung verlangen, um aussagekräftige Ergebnisse zu liefern. Im interdisziplinären Austausch können die Daten häufig nur eingeschränkt verwendet werden, da andere Berufsgruppen mit den Verfahrensweisen nicht vertraut sind.
Zur Strukturierung der Behandlungsmaßnahmen im Rahmen des THERA-Konzeptes bestand deshalb dringender Bedarf, ein einfaches und zugleich valides Instrument zur Beurteilung motorischer Fähigkeiten zu etablieren, das von allen am Rehabilitationsprozess beteiligten Berufsgruppen durchgeführt und interpretiert werden kann und ermöglicht, Patienten entsprechend ihrer Fähigkeiten in Behandlungsmodule einzuteilen.
Das THERA-Konzept Assessment ist abgeleitet von klinisch gut untersuchten und im Alltag erprobten Assessments, wie den Functional Ambulation Categories (FAC) und dem Statischen Gleichgewichtstest (SGT), der wiederum auf Items der Berg-Balance-Scale basiert [8][9]. Es erfasst Patientenfähigkeiten auf Aktivitätsebene, ist dadurch aufgabenorientiert einzusetzen, und ermöglicht eine schnelle und zuverlässige Beurteilung der posturalen Kontrolle, der Stehfähigkeit und (in Kombination mit dem FAC) der Gehfähigkeit.

- Platz T, VanKaik S (2007). Motorisches Assessment beiPatienten mit Schlaganfall. In: Dettmers C, Bülau P, Weiller C (Hrsg.): Schlaganfall Rehabilitation. Bad Honnef: Hippocampus Verlag.
- Stephan KM, Krause H, Hömberg V (2011). ICF-basierte Zieldefinition als Grundlage für eine rationale Rehasteuerung. In: Dettmers C, Stephan KM (Hrsg.): Motorische Therapie nach Schlaganfall. Von der Physiologie bis zu den Leitlinien.
- Pössl J, Schellhorn A, Ziegler W, Goldenberg G (2003). Die Erstellung individueller Therapieziele als qualitätssichernde Maßnahme in der Rehabilitation hirngeschädigter Patienten. Neurol Rehabil 9: 62-70.
- Wade DT (1998). Evidence relating to goal planning in rehabilitation. Clin Rehabil 12: 273-275.
- World Health Organization (2001). International Classification of Functioning, Disablility and Health.
- Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (BAR) e.V. (2015). ICF-Praxisleitfaden. Trägerübergreifende Informationen und Anregungen für die praktische Nutzung der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF)
- Mehrholz J (Hrsg.) (2011) Neuroreha nach Schlaganfall. Stuttgart, NewYork: Thieme Verlag.
- Mehrholz J (2007). Den Gang zuverlässig beurteilen. Zur Gehfähigkeit nach Schlaganfall: Die deutschsprachige Version der „Functional Ambulation Categories“ (FAC) – Reliabilität und konkurrente Validität. pt Zeitschrift für Physiotherapeuten 59(11): 1096-1102.
- Pickenbrock HM, Diel A, Zapf, A (2015). A comparison between the Static Balance Test and the Berg Balance Scale: Validity, reliability, and comparative resource use. Clin Rehabil (30) 3: 288-293.
Verwandte Inhalte
Meet our specialists.
Are you interested in our solutions? Schedule a meeting with a Consultant to talk through your strategy and understand how TEHRA-Trainer can help you to advance rehabilitation.
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen