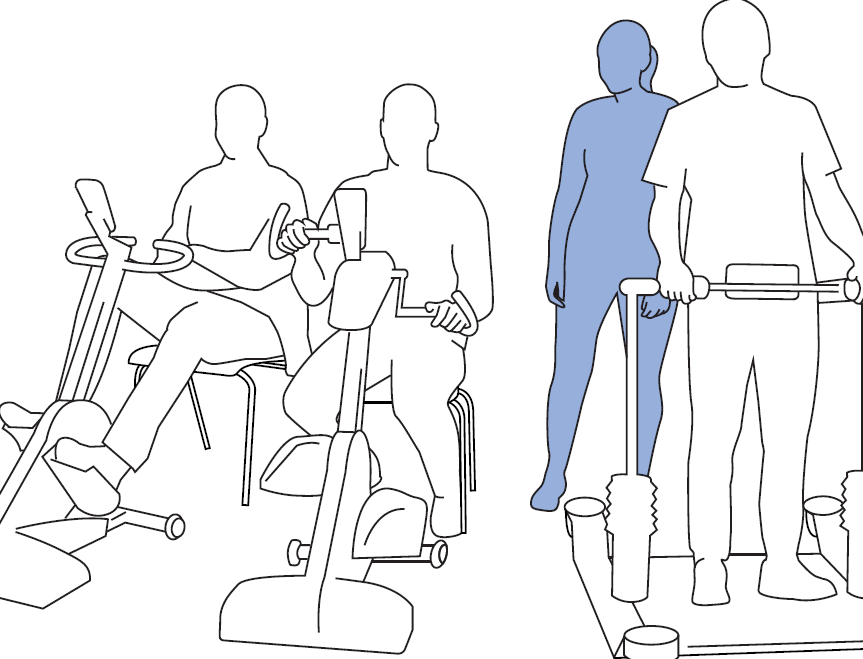
THERAPY-Magazin
Von der Evidenz zur klinischen Praxis
Die Implementierung evidenzbasierter Therapieansätze in die klinische Praxis ist entscheidend für die Verbesserung der Patientenversorgung. Erfahren Sie, wie das THERA-Konzept die Anwendung gerätegestützter Therapie in der neurologischen Rehabilitation effizient gestaltet.

Jakob Tiebel
Inhaber, N+ Digital Health Agency
Im Kontext der neurologischen Rehabilitation hat die evidenzbasierte Praxis eine große Bedeutung bekommen. Diverse Fachgremien haben es sich national und international zur Aufgabe gemacht Leitlinien zu entwickeln, die für therapeutische Entscheidungsfindung relevante Evidenz systematisch darzustellen. Die Absicht der Verfasser klinischer Leitlinien ist, eine Verhaltensänderung auf Anwenderseite zu generieren um damit eine Verbesserung der Versorgungsqualität herbeizuführen. Fakt ist jedoch: Es fehlt bisher an Lösungen zur Umsetzung in der Praxis.
Die moderne Neurorehabilitation ist zunehmend evidenzbasiert und trägt somit den sich stetig vertiefenden Erkenntnissen aus Grundlagen- und Interventionsforschung Rechnung. Zu Recht ist die Evidenzbasierung von Therapiemaßnahmen eine Forderung der Zeit und wird zunehmend zum Standard. Doch was genau verbirgt sich hinter dem Schlagwort »evidence based therapy«?
Der »Urvater« der evidenzbasierten Medizin Daniel Sackett definiert sie wie folgt: »Integration individueller klinischer Expertise mit der bestmöglichen externen Evidenz aus systematischer Forschung und den Erfahrungen und Wünschen des Patienten« [14].
In der evidenzbasierten Praxis steht also der bewusste, explizite und angemessene Einsatz gegenwärtiger wissenschaftlicher Erkenntnisse für die Wahl therapeutischer Maßnahmen im Mittelpunkt [14]. Daraus ergibt sich die grundlegende Frage: Welche der verfügbaren therapeutischen Maßnahmen sind für den individuellen Patienten zu einem bestimmen Zeitpunkt am besten geeignet? Die Antwort sollte stets unter Einbeziehung des Patienten und unter kritischer Abwägung vorhandener Möglichkeiten gesucht werden [1], da die Entscheidung von den persönlichen Zielen und Präferenzen des Patienten, der Erfahrung und Expertise des Therapeuten und den strukturellen Rahmenbedingungen abhängig ist [5][6].
Im Kontext der neurologischen Rehabilitation hat die evidenzbasierte Praxis eine große Bedeutung bekommen [7][11]. Diverse Fachgremien haben es sich national und international zur Aufgabe gemacht Leitlinien zu entwickeln, die für therapeutische Entscheidungsfindung relevante Evidenz systematisch zu sichten und darzustellen. Die Absicht der Verfasser klinischer Leitlinien ist es, eine Verhaltensänderung auf Anwenderseite zu generieren um damit eine Verbesserung der Versorgungsqualität herbeizuführen [15].
Trotz guter Fortschritte und einer insgesamt positiven Entwicklung besteht weiterhin Potential zur Verbesserung. »Leitlinien implementieren sich nicht spontan von selbst« [15] und wissenschaftliche Erkenntnisse der Fachverbände ergeben noch kein Behandlungskonzept, welches den Anforderungen des klinischen Alltags gerecht wird.
Der »Urvater« der evidenzbasierten Medizin Daniel Sackett definiert sie wie folgt: »Integration individueller klinischer Expertise mit der bestmöglichen externen Evidenz aus systematischer Forschung und den Erfahrungen und Wünschen des Patienten« [14].
In der evidenzbasierten Praxis steht also der bewusste, explizite und angemessene Einsatz gegenwärtiger wissenschaftlicher Erkenntnisse für die Wahl therapeutischer Maßnahmen im Mittelpunkt [14]. Daraus ergibt sich die grundlegende Frage: Welche der verfügbaren therapeutischen Maßnahmen sind für den individuellen Patienten zu einem bestimmen Zeitpunkt am besten geeignet? Die Antwort sollte stets unter Einbeziehung des Patienten und unter kritischer Abwägung vorhandener Möglichkeiten gesucht werden [1], da die Entscheidung von den persönlichen Zielen und Präferenzen des Patienten, der Erfahrung und Expertise des Therapeuten und den strukturellen Rahmenbedingungen abhängig ist [5][6].
Im Kontext der neurologischen Rehabilitation hat die evidenzbasierte Praxis eine große Bedeutung bekommen [7][11]. Diverse Fachgremien haben es sich national und international zur Aufgabe gemacht Leitlinien zu entwickeln, die für therapeutische Entscheidungsfindung relevante Evidenz systematisch zu sichten und darzustellen. Die Absicht der Verfasser klinischer Leitlinien ist es, eine Verhaltensänderung auf Anwenderseite zu generieren um damit eine Verbesserung der Versorgungsqualität herbeizuführen [15].
Trotz guter Fortschritte und einer insgesamt positiven Entwicklung besteht weiterhin Potential zur Verbesserung. »Leitlinien implementieren sich nicht spontan von selbst« [15] und wissenschaftliche Erkenntnisse der Fachverbände ergeben noch kein Behandlungskonzept, welches den Anforderungen des klinischen Alltags gerecht wird.
Implementierung in die klinische Praxis
In der Literatur werden diverse Strategien zur Implementierung evidenzbasierter Leitlinien in die klinische Praxis dargestellt und teils kontrovers diskutiert [4][3][2]. Empfohlen wird überwiegend eine »gemischte Lehrstrategie«, die den effektiven Wissenstransfer in die klinische Praxis sicherstellen soll [4]. Jan Mehrholz verweist auf ein Implementierungsmodell von Lomas [9] und Kitson et al. [8] die eine »Lehrstrategie durch Wissenstransfer« vorschlagen. Die Ergebnisse aus Wissenschaft, Forschung und Entwicklung sollen danach konsequent in die therapeutischen Entscheidungsprozesse integriert und unbedingt auch in der praktischen Anwendung geschult werden [15].
Das THERA-Konzept ist ein solches Implementierungsmodell. Und es ist das erste seiner Art, das Lösungen zur strukturierten und individualisierten Anwendung gerätegestützter Therapiemaßnahmen in die Praxis transferiert.
In Form eines Handlungsleitfadens und durch interaktive Workshops mit Klinikern und Praktikern trägt das THERA-Konzept dazu bei, dass therapeutische Maßnahmen, die im Rahmen der gerätegestützten Therapie ergriffen werden, rationaler und effektiver gestaltet werden . Dabei gilt es nicht nur den klinischen und ambulanten Anwendern, sondern auch den angrenzenden und nachgelagerten administrativen, ökonomischen und sozialen Kernbereichen, sowie Patienten und ihren Angehörigen eine Orientierung zu geben.
Übertragen auf das Implementierungsmodell von Lomas und Kitson bedeutet das die konsequente Ausrichtung an aktuellen Forschungsergebnissen und Erkenntnissen der Wissenschaft (siehe Abb. S. 21). Das THERA-Konzept ist überwiegend an den Praxisleitlinien »Schlaganfall« der Royal Dutch Society for Physical Therapy und der Deutschen Gesellschaft für Neurologische Rehabilitation [12][13] orientiert, die durch umfassende Literaturrecherche, großes Fachwissen und eine hohe Praxistauglichkeit gekennzeichnet sind.
Das THERA-Konzept ist ein solches Implementierungsmodell. Und es ist das erste seiner Art, das Lösungen zur strukturierten und individualisierten Anwendung gerätegestützter Therapiemaßnahmen in die Praxis transferiert.
In Form eines Handlungsleitfadens und durch interaktive Workshops mit Klinikern und Praktikern trägt das THERA-Konzept dazu bei, dass therapeutische Maßnahmen, die im Rahmen der gerätegestützten Therapie ergriffen werden, rationaler und effektiver gestaltet werden . Dabei gilt es nicht nur den klinischen und ambulanten Anwendern, sondern auch den angrenzenden und nachgelagerten administrativen, ökonomischen und sozialen Kernbereichen, sowie Patienten und ihren Angehörigen eine Orientierung zu geben.
Übertragen auf das Implementierungsmodell von Lomas und Kitson bedeutet das die konsequente Ausrichtung an aktuellen Forschungsergebnissen und Erkenntnissen der Wissenschaft (siehe Abb. S. 21). Das THERA-Konzept ist überwiegend an den Praxisleitlinien »Schlaganfall« der Royal Dutch Society for Physical Therapy und der Deutschen Gesellschaft für Neurologische Rehabilitation [12][13] orientiert, die durch umfassende Literaturrecherche, großes Fachwissen und eine hohe Praxistauglichkeit gekennzeichnet sind.
Das THERA-Konzept
Auf Grundlage aktueller Evidenz bietet das THERA-Konzept umfassende Expertise für alle Einrichtungen, die sich um eine aktive Rehabilitation und Pflege von Menschen kümmern. Kern des Konzeptes ist ein praxisorientierter Handlungsleitfaden der einen zielgerichteten Einsatz der THERA-Trainer Produkte über alle Phasen der Rehabilitation hinweg möglich macht. Dies geschieht auf Grundlage neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse, unter Berücksichtigung aller angrenzenden Bereiche. Entwickelt wurde das THERA-Konzept gemeinsam mit Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Ärzten, Ingenieuren und IT-Experten.
Auf Grundlage aktueller Evidenz bietet das THERA-Konzept umfassende Expertise für alle Einrichtungen, die sich um eine aktive Rehabilitation und Pflege von Menschen kümmern. Kern des Konzeptes ist ein praxisorientierter Handlungsleitfaden der einen zielgerichteten Einsatz der THERA-Trainer Produkte über alle Phasen der Rehabilitation hinweg möglich macht. Dies geschieht auf Grundlage neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse, unter Berücksichtigung aller angrenzenden Bereiche. Entwickelt wurde das THERA-Konzept gemeinsam mit Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Ärzten, Ingenieuren und IT-Experten.
Ambulante Rehabilitation
Fachkreise
Intensiv- & Akutpflege
Stationäre Rehabilitation
Therapie & Praxis
THERAPY Magazin

Jakob Tiebel
Inhaber, N+ Digital Health Agency
Jakob Tiebel Studium in angewandter
Psychologie mit Schwerpunkt
Gesundheitswirtschaft. Klinische
Expertise durch frühere
therapeutische Tätigkeit in der
Neurorehabilitation. Forscht und
publiziert zum Theorie-Praxis-
Transfer in der Neurorehabilitation
und ist Inhaber von Native.
Health, einer Agentur für digitales
Gesundheitsmarketing.
References:
- Dawes M, Summerskill W, Glasziou P et al. (2005) Sicily statement on evidence based.
- Greenhalgh T, Robert G, Macfarlane F et al. (2004). Diffusion of innovations in service organizations: systematic review and recommendations. Milbank Q 82:581-629.
- Grimshaw JM, Thomas RE, MacLennan G et al. (2004). Effectiveness and efficiency of guideline dissemination and implementation strategies. Health Technol Asses 8: 72.
- Grol R, Grimshaw J (2003). From best evidence to best practice: effective implementation of change in patients’s care. Lancet 362: 1225-1230.
- Haynes RB (2002a). What kind of evidence is it that Evidence-Based Medicine advocates what health care providers and consumers to pay attention to? BMC Health Serv Res. 2: 3-10.
- Haynes RB, Deveraux PJ, Guyatt GH (2002b). Clinical expertise in the era of evidence-based medicine and patient choice. Vox Sang. 83(Suppl 1): 383-386.
- Holm M (2000). Our mandate fort he new millenium: evidence based practice. Am J Occup Ther. 54: 575-585.
- Kitson A, Harvey G, McCormack B (1998). Enabling the implementation of evidence based practice: a conceptual framework. Qual Health Care 7: 149-158.
- Lomas, J (1993). Teaching old (and not so old) does new tricks: effective ways to implement research findings. In: Dunn, EV et al.: Volume 6: Disseminating research/ changing practice. London: Sage.
- practice. BMC Med Educ. 5: 1-7.
- Parker-Taillon D (2002). CPA initiatives put the spotlight on evidence-based practice in physiotherapy. Physiother Can. 24: 12-15.
- ReMoS Arbeitsgruppe (2015). S2e-Leitlinie. Rehabilitation der Mobilitat nach Schlaganfall (ReMoS).
- Royal Dutch Society for Physical Therapy (2014). KNGF Guideline, Stroke.
- Sackett DL, Rosenberg WMC, Gray JAM et al. (1996) Evidence based medicine: what it is and what it isn’t. BMJ 312: 71-72.
- VanPeppen R, Mehrholz J (2011) Evidenzbasierte Rehabilitation nach Schlaganfall. In: Mehrholz, J. (Hrsg): Neuroreha nach Schlaganfall. Stuttgart, NewYork: Thieme Verlag.
Verwandte Inhalte
Meet our specialists.
Are you interested in our solutions? tzkjtrzktzkmrz Schedule a meeting with a Consultant to talk through your strategy and understand how TEHRA-Trainer can help you to advance rehabilitation.